Hauptinhalt

What are the potentials, contradictions, and limits of urban scholarship that aspires to be both analytical and transformative? The 2026 IRS Spring Academy will address this question.

In der aktuellen Folge des Podcasts Society@Space dreht sich alles um Innovationsförderung in ländlichen und strukturschwachen Räumen. Was hat es mit dem weiten Innovationsbegriff auf sich? Und wie können Innovationen überhaupt effektiv gefördert werden? Darüber sprechen Jonathan Hussels, Daniel Schiller und Simon Senft.
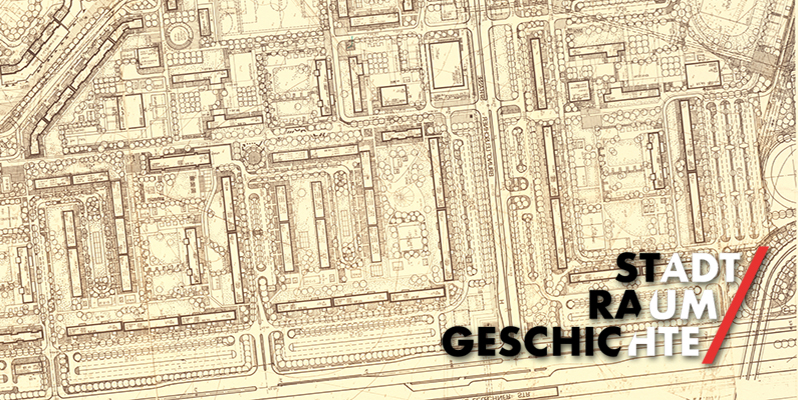
Das Fachportal „Stadt-Raum-Geschichte.de“ ist Teil der Digitalstrategie des Forschungsschwerpunkts „Zeitgeschichte und Archiv“. Die einzigartigen Bestände der Wissenschaftlichen Sammlungen werden dort nach und nach digital zugänglich gemacht. Pläne, Fotos und Architekturentwürfe können thematisch und in einer Kartenansicht gesucht werden. Zudem gibt das Portal Einblicke in die Forschungsaktivitäten des Schwerpunkts.

Ob Windrad oder Wohnungsbau – Planungsprojekte sind zunehmend von Konflikten geprägt. Jede Auseinandersetzung um die Gestaltung der Zukunft wird heute belastet von Grundsatzkonflikten um Identität, Zugehörigkeit und Wahrheit. Diese Ausgabe berichtet unter anderem von Konflikten um LNG-Terminals auf Rügen und in Wilhelmshaven, vom vermeintlichen Konflikt zwischen sozialer und klimafreundlicher Wohnungspolitik und vom Umgang mit rechter Mobilisierung in Städten.









