Hauptinhalt
Sozialökologische Transformation – was bleibt vom Aufbruch?
Erkenntnisse aus dem Raumwissenschaftlichen Kolloquium 2025
Noch vor wenigen Jahren wurde ökologische Transformation, speziell der Klimaschutz, mit großer gesellschaftlicher und politischer Unterstützung vorangetrieben. Davon ist heute wenig übrig. Stattdessen: heftige Konflikte, Blockade und zum Teil politisch getriebener Rückbau. Ist die „große“ Transformation vorbei, bevor sie begonnen hat? Und wenn ja, wie können Wissenschaft und Praxis damit umgehen? Diesen Fragen widmete sich Ende Juni das Raumwissenschaftliche Kolloquium in Berlin.
Am 26. Und 27. Juni kamen rund 90 Fachleute aus Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf dem Berliner GLS Campus zusammen, um den aktuellen Stand der sozial-ökologischen Transformation zu diskutieren. Seit 2005 richtet das Leibniz-Forschungsnetzwerk „Räumliches Wissen für Gesellschaft und Umwelt | Spatial Knowledge for Society and Environment“, kurz „Leibniz R“, alle zwei Jahre das Raumwissenschaftliche Kolloquium aus. In diesem Jahr hatten das Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) und das Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) die Federführung. Erstmals fand die Veranstaltung zweisprachig, auf Deutsch und Englisch statt, um auch internationale Forschende und Praktiker*innen anzusprechen.

Die einführende Keynote des ersten Tages hielt Andreas Novy, Professor für Sozioökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Unter dem Titel „Multi-level transformations as a strategy for a viable economic future“ rekurrierte er zunächst auf Karl Polanyi, um die historische Entwicklung der reaktionären Rechten aufzuzeigen und zugleich länger- von kurzfristigen Perspektiven auf Transformation zu unterscheiden. Der neoliberale Globalismus sei im Rahmen der Klima- und Coronakrise an seine Grenzen gestoßen. Die Kritik an der Globalisierung komme dabei zunehmend von rechts und gefordert werde ein nationalistischer Kapitalismus. Die progressiven Kräfte hingegen seien gespalten: Während einige Akteure betonen, dass globale Probleme nur global gelöst werden können, fokussieren andere verstärkt die lokale Ebene. Andreas Novy schlägt vor, Handlungsspielräume auf verschiedenen Ebenen zu nutzen, um innerhalb der planetarischen Grenzen ein gutes Leben für möglichst viele zu ermöglichen. Auf lokaler Ebene könnten bspw. Wirtschaftsbereiche der Alltagswirtschaft wie Gesundheit, Wohnen, Energie oder auch regionale Ernährungssysteme transformiert werden. Auf nationaler und EU-Ebene würden Industrie- und Steuerpolitik fortschrittliche Handlungsansätze bieten, während auf globaler Ebene die Regulierung der Handelsbeziehungen und die Begrenzung der globalen Finanzmärkte zentral seien.

Die zweite Keynote hielt Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes (UBA). In seiner Keynote „Conditions for success and pitfalls of transformation“ machte er deutlich, dass es um 2020 herum eine sehr optimistische Stimmung gab und auch einiges an konkreten Umsetzungen. Leider sei von diesem Optimismus inzwischen nicht mehr viel zu spüren. Er sieht daher eine stärker sozialverträglich ausgerichtete Umwelt- und Klimapolitik und faire Lastenverteilung als essenziell an, damit die sozial-ökologische Transformation gesellschaftliche Legitimation erfahre und so wieder mehr Fahrt aufnehme. Ebenso wie Andreas Novy betonte Messner die Bedeutung einer breiten Unterstützungskoalition für Transformation, die explizit die Wirtschaft mit einschließt. In diesem Zusammenhang verwies er auf das starke Wachstum der „grünen Technologien“. Trotz aller Rückschläge bewertete er die bisher gemachten Fortschritte, gerade bei der Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft, positiv. Das Auf und Ab ordnete er in die Verläufe früherer „moralischer Revolutionen“ ein, die ebenfalls eine radikale Neuordnung von Wertvorstellungen und gesellschaftlichen Routinen erforderten.

In der dritten Keynote berichtete Anna Lisa Boni als stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Bologna und zuständig für die EU/Recovery funds und climate mission 2030 aus der Praxis. Sie stellte die EU-Mission der 100 Städte vor, die bis 2030 Klimaneutralität anstreben, und verwies auf die massiven Anstrengungen europäischer Kommunen zur Bekämpfung des Klimawandels. Die angestrebten Lösungen basieren auf einem sektor- und akteursübergreifenden Ansatz auf mehreren Ebenen und werden in Klimastadtverträgen geregelt, die eine neue Governance auf breiter Ebene erfordern. Anna Lisa Boni stellte den Stand der Umsetzung in Bologna vor. Sie verfügt über 30 Jahre Berufserfahrung in der EU-Politik auf lokaler und regionaler Ebene und hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Herausforderungen der Städte auf der europäischen Agenda stärker berücksichtigt werden. Heute ist es ihr Ziel, Bologna zu einer klimaneutralen, digitalen und integrativen Stadt zu machen.

Bei den parallelen Panels stand am ersten Tag der Widerstand gegen Transformationen im Fokus. Panel 1 „Local resistances: Social and spatial justice demands on industrial projects of Green Transitions“ wurde von Markus Sattler (IfL) moderiert. Die Inputs in diesem Panel fokussierten die lokalen Verhandlungen und den Widerstand der Bevölkerung gegen Projekte des den „grünen“ Wandels, etwa Produktionsstätten von Elektrobatterien und Elektrofahrzeugen in Europa. Dabei berichtete Linda Szabó vom Periféria Policy and Research Center über soziale Unzufriedenheit in Ungarn im Kontext von Batterieinvestitionen zur Versorgung der europäischen Produktion emissionsarmer Fahrzeuge. Janine Korduan von der Bürgerinitiative Grünheide sprach über mobilisierenden Widerstand gegen die Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg und Hannes Langguth von der HafenCity Universität Hamburg referierte über chinesische Grüntechnologie-Großprojekte in ostdeutschen Kleinstädten.

Panel 2 „Populismus, Gerechtigkeit und Bevormundungsgefühle“ wurde von Frank Meyer (ebenfalls IfL) moderiert und nahm die Widerstände gegen sozial-ökologische Transformationen auf verschiedenen politisch-administrativen Ebenen in den Blick. Das Panel diskutierte zudem, in welchem Verhältnis regionale Schrumpfungsprozesse und Transformation stehen und welche Rolle Populismus dabei spielt. Jakob Schwörer von der Leuphana Universität Lüneburg sprach über neue politische Dynamiken und den Backlash beim Klimaschutz in Westeuropa. Seit 2019 wird das Thema Klima bei rechten Parteien relevanter, u. a. wegen der Proteste von Fridays for Future. Der Anti-Klimaschutz entwickelt sich zunehmend zum Markenkern rechter Parteien, wenn auch nicht in demselben Ausmaß wie beim Thema Migration. Sebastian Henn von der Universität Jena berichtete über regionale Verbitterung sowie emotionale Lock-Ins in Thüringen und unterstrich die Notwendigkeit neuer regionalpolitischer Ansätze. Er setzt dabei auf eine Politik, die an Emotionen anknüpft, was in der Diskussion durchaus kontrovers diskutiert wurde, da die Emotionalisierung von Politik in der Vergangenheit in erster Linie der radikalen Rechten genutzt hat. Ludger Gailing, Professor für Regionalplanung an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, befasste sich mit Gerechtigkeitsaspekten von Transformation und berichtete empirisch aus der Lausitz. Dabei hielt er fest, dass Gerechtigkeitsdiskurse immer auch Ungerechtigkeitsdiskurse sind und es in der Transformation einen Dreiklang aus Verteilung, Beteiligung und Anerkennung braucht. Dem schloss sich auch Korina Jenßen vom Bündnis Gleichstellung Lausitz an. Sie hob die Bedeutung von Netzwerken und breiten Bündnissen in Transformationsprozessen besonders hervor.

Das Panel 3 „Sozial-ökologische Transformation – Last oder Chance für Regionen jenseits urbaner Zentren?“ wurde von Markus Egermann, Artem Korzhenevych und Sabine Marr (alle Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung) moderiert. Sie rückten die dünn besiedelten, bisweilen als „strukturschwach“ klassifizierten Regionen in den Fokus der sozial-ökologischen Transformation. Die Ausweisung von Naturschutz-, und Vorranggebieten für den Ausbau erneuerbarer Energien ist nur ein Beispiel das verdeutlicht, wo globale Nachhaltigkeitsziele auf lokale Realitäten treffen. In vielen dieser Regionen wird das als Chance verstanden, zugleich aber auch als Last wahrgenommen, die zusätzlich zu Herausforderungen wie Überalterung, Abwanderung, leeren kommunalen Kassen und gesellschaftlicher Polarisierung bearbeitet werden muss. Die Diskussion zeigte, dass erfolgreiche Transformation bestehende Paradigmen, Normen und Bewertungsmaßstäbe hinterfragen muss.

Am zweiten Tag standen Aufbrüche im Mittelpunkt der Sessions. Das Panel 4 widmete sich im Kontext „Aufbrüche“ dem Thema „Öffentliche Verwaltung als Change-Agent?“ Es wurde von Antje Bruns, Generalsekretärin der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (ARL) und ARL-Vizepräsident Markus Hesse moderiert. Im Fokus stand die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit öffentlicher Verwaltungen angesichts der Größe und Komplexität der anstehenden Transformationsaufgaben. Das Panel brachte dazu Forschung und öffentliche Verwaltung in einen Dialog: Tiaji Sio von Mission Lead, Re:form hob in ihrer Präsentation hervor, dass der Fachkräftemangel dazu führe, dass der Staat kein attraktiver Arbeitgeber mehr sei. Um trotzdem Verwaltungspionier*innen für den Staat von morgen zu gewinnen, sei es notwendig, parteiübergreifend und über politisch-administrative Hierarchien und Ebenen hinweg zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
Gijs Diercks vom Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) rückte in seinem Impuls „Accelerating Transitions from within – the role of public servants” die Frage in den Blick, wie aktivistisch oder politisch engagiert Staatsbedienstete sein dürfen, und lud damit zu einer engagierten Diskussion ein. Philipp Männle vom Ministerium für Justiz und Gesundheit Schleswig-Holstein und Universität Potsdam rekurrierte in seinem Input „Innovative Verwaltung als Motor für Veränderungen“ auf Luhmann und die Soziologie des zweiten Blicks. Er unterstrich überdies die Wirkungsmittel „Recht“ und „Geld“ in Verwaltungen, die maßgeblich mit darüber entscheiden, wie sich Handlungsspielraum ausgestaltet.

Das Panel 5 „Experimentation and new players in regional change processes“ wurde von Suntje Schmidt (IRS) moderiert. Es rückte soziale Innovationsprozesse, sozial orientiertes Unternehmertum, gemeinnützige Genossenschaften oder Gemeinschaften in temporären Projekten sowie in Experimentierräumen in den Blick. Da die Akteure in der Regel eine gemeinsame Wahrnehmung eines Problems vereint, zu dessen Lösung sie beitragen wollen, können lokal sehr wertvolle Lösungen entstehen. Doch wie lassen sich diese auf andere räumliche Kontexte übertragen und wie können sie nachhaltig gestaltet werden? Die Referierenden diskutierten die Frage, wie lokale Experimente vernetzt werden können und wie soziale Innovationen zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können.
Daniel Schiller von WIR!, T!Raum, innovative Region betonte in seinem Beitrag „Engaging the Society in Regional Innovation: Beispiele von Bioeconomy und One Health Allianzen in Vorpommern“ das große Potenzial für Regionalentwicklung und Lebensqualität. Anna-Lisa Heye von der Hochschule Bochum befasste sich in ihrem Input „Addressing implementation gaps: The InnovationsCommunity Urban Health (ICUH) Project“ mit der Frage, warum Erkenntnisse aus der Wissenschaft und akzeptierte Leitbilder wie das der Nachhaltigkeit oder der gesundheitsfördernden Stadtentwicklung in der Praxis oft nicht umgesetzt werden können. George Tsekouras, Associate Professor on Innovation and Entrepreneurship an der University of Greenwich, skizzierte die Herausforderungen und Lösungen für mehr Innovations- und Industriepolitik. Ralph Richter (IRS) hob schließlich das Potential zur Skalierung innovativer Lösungen durch Rollenmodellierung hervor.
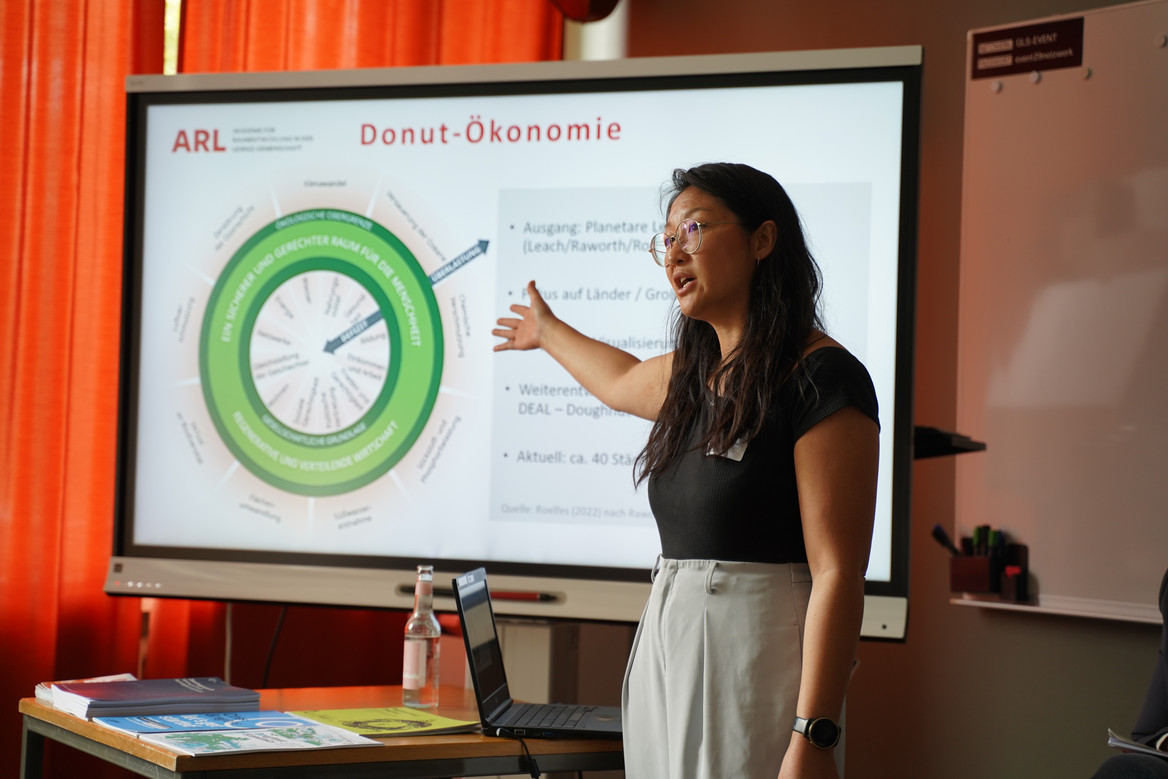
Das Panel 6 „Regionale Transformation: Wie kommen alternative Wohlstandsmodelle in die regionale Praxis?“ wurde von Martina Hülz (ARL) moderiert. Im Zentrum stand die Frage, wie Wohlstand neu gedacht und regional umgesetzt werden kann. Christian Schulz (Universität Luxemburg) führte mit seinem Impuls in die Donut-Ökonomie ein. Das Modell verbindet planetare Grenzen mit sozialen Mindeststandards und bietet eine klare Leitlinie für nachhaltige Entwicklung. Yuge Lei (Referentin für Nachhaltigkeit und Innovation der Stadt Bad Nauheim) machte diese Vision anschaulich: Ihre Stadt nutzt den Donut-Ansatz in der Planungspraxis. Ein Beispiel dafür, wie Kommunen mit systemischem Denken Nachhaltigkeit aktiv gestalten können.
Bastian Lange (Humboldt-Universität zu Berlin / Multiplicities - Designing Transitions) rückte im Anschluss die Governance-Perspektive in den Fokus: Transformation gelingt nicht allein durch Top-down-Ansätze, sondern durch Kooperation, geteilte Verantwortung und Räume für Experimente. Ela Kagel (Platform Coops eG) stellte das Modell des Community Buyout vor – eine Praxis, bei der Menschen gemeinsam Ressourcen erwerben, um sie dauerhaft dem Markt zu entziehen und kollektiv zu verwalten. Ob Genossenschaften, Community Land Trusts oder das Mietshäuser Syndikat – solche solidarischen Strukturen, machen die Ansätze und Potentiale gemeinwohlorientierter Strukturen sicht- und erfahrbar.
Der Austausch zeigte, dass Transformation dort beginnt, wo Menschen gemeinsam handeln, experimentieren und Besitz neu organisieren. Es braucht Mut, Strukturen zu hinterfragen, aber auch konkrete Werkzeuge, um Alternativen zu etablieren und zu erkennen, dass alternative Wohlstandsmodelle keine Utopie sind – sie entstehen bereits jetzt, lokal und gemeinschaftlich.


In der von Jörn Knobloch (IfL) moderierten Podiumsdiskussion zogen ARL-Generalsekretärin Antje Bruns, IfL-Direktorin Judith Miggelbrink, IRS-Direktor Oliver Ibert gemeinsam mit Tobias Till Kreye (Gründer des Projektes N – Agentur für Nachhaltige Entwicklung) ein Resümee der beiden Kongresstage. Deutlich wurde, dass Transformation ein vielschichtiger Prozess mit offenem Ausgang ist, Veränderungen nicht „von oben“ verordnet werden können, sondern zivilgesellschaftliches Engagement eine zentrale Rolle spielt, wenn es um die Frage geht, wie wir besser nachhaltiger zusammenleben können. Dazu müssen Themen des Wandels stärker in gesellschaftspolitische Debatten gebracht und Erzählungen gelungener Transformationsprozesse in die Öffentlichkeit kommuniziert werden. Zugleich ist die Modernisierung von Staat und Verwaltung unerlässlich für das Gelingen von Transformationsprozessen.
Transformation werde paradox erlebt: Während einigen der Wandel zu schnell gehe, dauert anderen alles zu lange. Dennoch habe es in den vergangenen Jahrzehnten deutliche Veränderungen in die richtige Richtung gegeben. Eine nachhaltige Entwicklung muss gerecht(er) sein. Die Aufgabe von Wissenschaft sei es, zu beobachten, Fakten zu erheben und den Fake News gesichertes Wissen gegenüberzustellen; dabei müsse sie stets offen und selbst lernfähig bleiben und sich neuen Formen der (partizipativen) Wissensproduktion öffnen. Aber Wissenschaft kann und muss auch politische Strategien in den Blick nehmen und analysieren, wo diese hinführen und diese Entwicklungen benennen.
Text von Dr. Tanja Ernst (ARL)
Eine Video-Dokumentation des Raumwissenschaftlichen Kolloquiums 2025 sowie Aufzeichnungen der drei Keynotes sind in Vorbereitung und werden online für alle Interessierten zur Verfügung gestellt.


